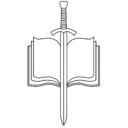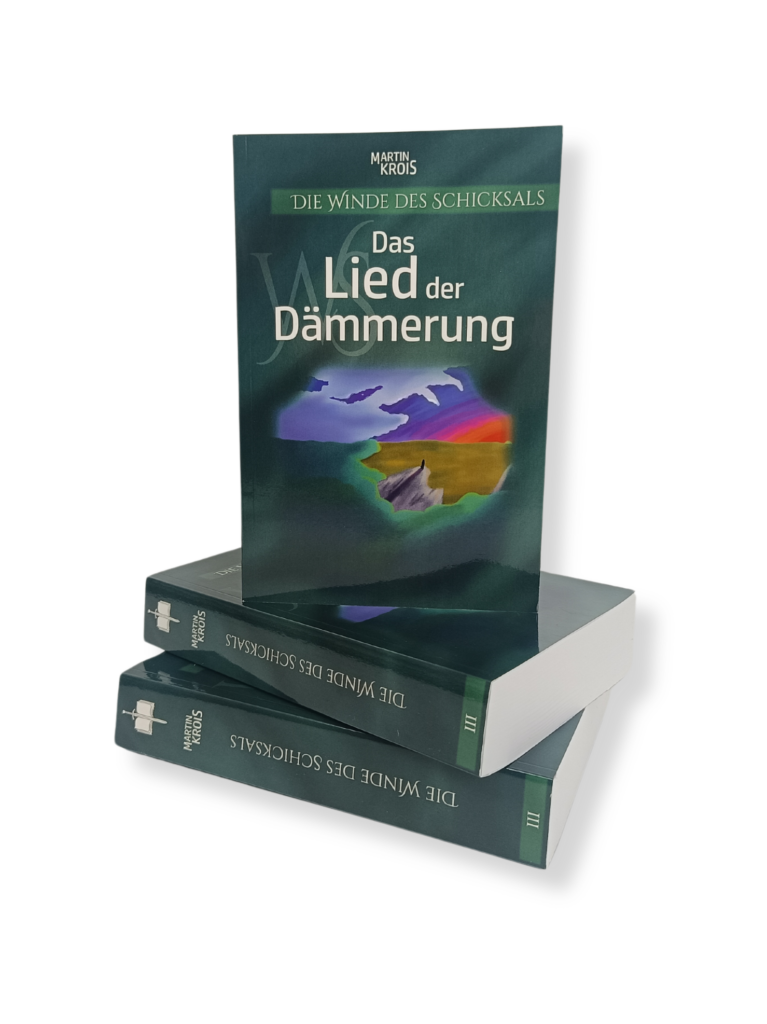
Einleitung
Wir schreiben das Jahr 2366 des Eisernen Zeitalters.
Ein Jahr ist vergangen, seit Omrunas und die Mursogi in der Schlacht von Varuvils Wall geschlagen wurden. Der feindliche Heerführer ist tot, seine Truppen zerstreut. Der ersehnte Friede hält in den Reichen des Nordens Einzug.
Schon weicht der Frühling ein weiteres Mal dem Sommer, als in der Wildnis Guilars ein seltsamer Mann erwacht. Ohne Erinnerung macht er sich auf die Suche nach seinem früheren Selbst, unwissend, dass er ein düsteres Geheimnis hütet. Noch ahnt er nicht, dass sein Erscheinen eine Zeit der Vorzeichen einläutet.
So wird der Mann zum Spielball der Winde des Schicksals, während die Erfüllung einer uralten Offenbarung unaufhaltsam näherrückt …
Lasst Euch von den Winden des Schicksals tragen, wie es Euch beliebt:
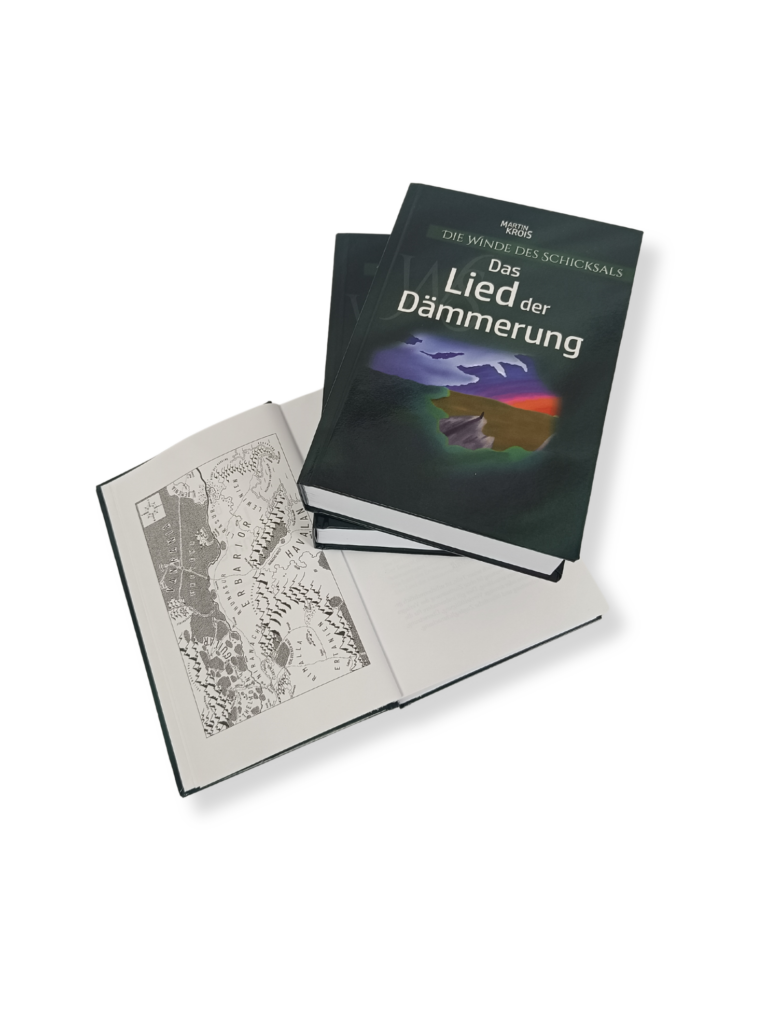
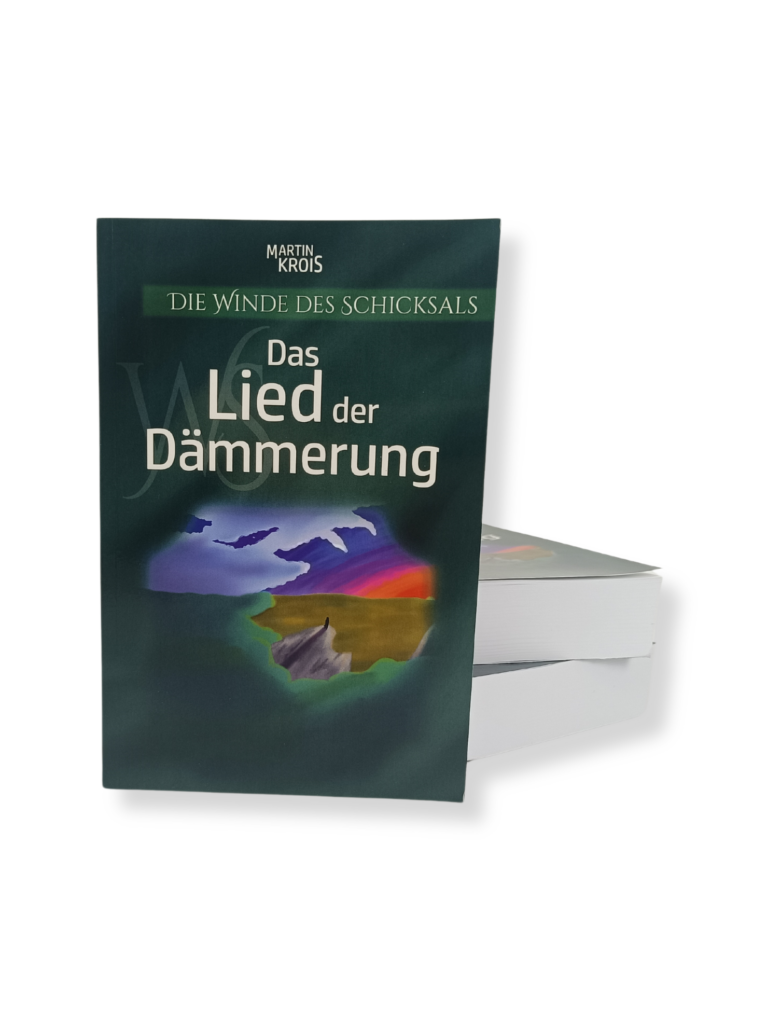


Leseprobe aus Kapitel I
Auf einer kleinen Lichtung entdeckte er ein Lager. Um eine niedergebrannte Feuerstelle hatte jemand sechs Zelte aus zerschlissenem schwarzem Stoff aufgeschlagen, die alles andere als einladend wirkten. Da jegliche Ordnung und Befestigung fehlte, war dies offensichtlich nicht der Außenposten eines Heeres. Wohl hätte man es durch seine fremdländische Aufmachung für das Lager fahrender Händler halten können, doch wirkte es dafür allzu heruntergekommen. Zudem waren weder Zugtiere noch Karren noch eine Straße zu sehen. So mochte es wohl Räubern als Zuflucht dienen, doch irgendetwas störte den Mann an dieser Vermutung.
Da er also nicht wusste, wem das Lager gehörte und wie ihn dessen Bewohner empfangen mochten, ging er nicht geradewegs darauf zu. Kaum zehn Schritte vom nächsten Zelt entfernt fand er eine Eiche mit niedrigen Ästen, die er erklomm. Von dort oben hatte er eine bessere Sicht auf die Lichtung, während die regennassen Blätter ihn vor unfreundlichen Augen verbargen.
Aufmerksam ließ er seinen Blick schweifen, doch nirgendwo war jemand zu sehen. Nur ein einzelner roter Fuchs erkundete schnüffelnd die Umgebung der heruntergebrannten Feuerstelle. Ob das Lager wohl verlassen worden war? Wenn dem so war, hatten die ehemaligen Bewohner bestimmt nichts dagegen, wenn sich ein Mann in Not von dem bediente, was sie zurückgelassen hatten.
Anmutig ließ er sich von seinem Ausguck zu Boden gleiten, um geduckt in Richtung der Zelte zu schleichen. Dabei versuchte er möglichst keine Geräusche zu verursachen, was ihm mangels Schuhwerk auch ohne Schwierigkeiten gelang. Immer wieder hielt er kurz inne, um zu lauschen, ob da nicht doch Stimmen oder Schritte zu hören waren. Doch nur das Geräusch des Regens durchbrach die Stille.
Als er zwischen zwei Zelte trat, entdeckte er etwas Absonderliches. Auf dem Boden vor ihm lag eine Leiche. Bei dem Toten handelte es sich jedoch nicht um einen Menschen. Was da lag, hatte zwar entfernt Ähnlichkeiten mit einem Menschen und trug auch eine Rüstung ähnlich derer, wie Menschen sie trugen, war aber mit Sicherheit kein Mensch. Die Hände und Füße des Geschöpfes endeten in Krallen. Sein Kopf war langgezogen wie der einer Eidechse und von zwei Hörnern gekrönt, die nach hinten gebogen waren.
Ein Mursog, erkannte der Mann. Das war eine Bezeichnung, die er nicht vergessen hatte. Zudem wusste er, dass er sich vor Wesen dieser Art in Acht nehmen musste, da sie Menschen für gewöhnlich nicht allzu freundlich gesinnt waren. Dieser eine würde ihm freilich nicht allzu gefährlich werden, denn ein grüngefiederter Pfeil ragte unterhalb der Hörner aus dessen Nacken.
Der Mann kniete nieder, um den Boden im Umkreis der Leiche zu überprüfen. Der Regen hatte die meisten Spuren verwischt, doch glaubte er die Fährte mehrerer Mursogi, daneben aber auch schmale Stiefelabdrücke erkennen zu können. Dabei griff er erneut unterbewusst auf Wissen aus seinem früheren Leben zurück. Er verstand sich also darauf, Fährten zu lesen. Sein Verdacht, er wäre so etwas wie ein Jäger gewesen, erhärtete sich.
Er hielt sich nicht lange damit auf, über diese Erkenntnis nachzugrübeln. Vorsichtig sah er sich auf der Lichtung um. Er fand fast zwei Dutzend Mursogi, die teils in den Zelten, teils davor ein gewaltsamer Tod ereilt hatte. Manchen war die Kehle durchgeschnitten worden, andere hatten Wunden wie von Pfeilen davongetragen. Seltsamerweise fehlte allen außer dem ersten das linke Horn.
Dieses Lager war ohne Zweifel das der Mursogi gewesen. Irgendjemand musste es angegriffen haben, doch gab es außer dem grüngefiederten Pfeil und den Stiefelabdrücken keinerlei Hinweise darauf, wer oder wie viele die Angreifer gewesen waren. Aus dem Zustand der Leichen schloss er jedoch, dass der Kampf noch nicht allzu lange her war – einige Stunden vielleicht, allerhöchstens einen Tag.
Die Wahrscheinlichkeit war also groß, dass im Lager noch irgendetwas Brauchbares zu finden war. Nahrungsmittel, Kleidung, Waffen oder andere Werkzeuge wären ihm sehr willkommen gewesen. Während er darüber nachdachte, spürte er plötzlich, wie etwas Kaltes seinen Rücken berührte.
»Na, was haben wir denn da?«, knurrte eine hässliche Stimme. Es war ohne Zweifel die eines Mursogs.
Als der Mann sich umdrehen wollte, ritzte eine scharfe Klinge seine Haut. Er fühlte, wie warmes Blut über seinen Rücken lief.
»Rühr dich nicht, du widerlicher Toroog!«, befahl der Mursog. »Ihr verfluchten Menschen habt schon genug Schaden angerichtet. Gnurlok ist tot und meine geliebte Truzagnul. Dafür werdet ihr bezahlen … Ich werde dafür sorgen, dass ihr die Namen meiner Freunde fürchtet. Und meinen Namen werdet ihr auch fürchten … Dafür werde ich sorgen, ja.«
Der Mann bemerkte, wie Wut in ihm aufstieg. Furcht dagegen verspürte er keine. Nun stand er mittellos im Regen, hungrig und mit Dreck überzogen und dann wurde er auch noch von einem dahergelaufenen Mursog bedroht.
»Warum bist du dann noch hier?«, fragte er herausfordernd. »Deine Freunde sind tot, du aber nicht. Warum? Haben sie dich verschont, weil sie Mitleid hatten? Oder bist du einfach weggelaufen und hast deine Freunde wie ein Feigling im Stich gelassen?«
»Halt dein Maul, du hornloser Kriecher!«, knurrte der Mursog. »Die sind tot, ich lebe. Mehr zählt nicht. Und das hier gehört jetzt alles mir.« Er kicherte leise. »Du hast uneingeladen mein Reich betreten. Das bedeutet, dass dein Leben jetzt mir gehört. Aber du hast Glück. In meinem Reich werde ich fleißige Diener brauchen …«
Der Mursog schien den Verstand verloren zu haben und sich für eine Art König zu halten. Doch seine Herrschaft würde nicht allzu lange andauern, wenn es nach dem Mann ging. Während er dem zunehmend sinnlosen Gestammel des Wahnsinnigen lauschte, überlegte er, wie er diesen am schnellsten unschädlich machen konnte.
»Wie wäre es, wenn du jetzt einfach deine Waffe sinken lässt?«, versuchte er es schließlich mit Vernunft, jedoch ohne große Hoffnung auf Erfolg. »Ich würde dir nur ungern wehtun.«
Für diesen Vorschlag hatte der Mursog erwartungsgemäß nur ein verächtliches Schnauben übrig. Daraufhin zuckte der Mann mit den Schultern. »Du hast es so gewollt. Ich habe dich gewarnt.«
Blitzschnell duckte er sich. Gleichzeitig zog er dem Mursog mit einem geschickten Tritt aus der Drehung die Beine unter dem Körper weg. Das gehörnte Geschöpf ging mit einem überraschten Aufschrei zu Boden. Ein weiterer Tritt traf seine rechte Hand, sodass es sein Schwert fallen ließ.
Die Fäuste zu einer Kampfhaltung erhoben, blickte der Mann auf seinen entwaffneten und nicht mehr ganz so selbstsicheren Feind hinab. »Ich warne dich noch einmal: Geh jetzt und ich lasse dich ziehen. Ich habe keinen Streit mit dir«, sagte er, wenngleich ihm schwante, dass seine Worte auf taube Ohren stoßen würden.
Der Mursog rappelte sich knurrend auf, nur um sich dann mit seinen klauenbewehrten Händen auf sein Gegenüber zu stürzen. Mit seiner Linken fing der Mann den Schlag des Mursogs ab, während er gleichzeitig mit der Rechten zuschlug und den langgezogenen Schädel seines Gegners traf. Stöhnend taumelte dieser zurück.
Der Kampf war bereits entschieden. Wenngleich der Mann nichts hatte außer seiner nackten Haut zum Schutz und seinen bloßen Händen zum Angriff, war er dem in einer verbeulten Rüstung steckenden, krallenbewehrten Mursog überlegen.
Obwohl das Geschöpf mittlerweile ebenfalls zu dieser Einsicht gekommen sein musste, gab es nicht auf. Stattdessen zückte es einen schartigen Dolch mit beinernem Griff und stieß mit einem schrillen Schrei nach dem Mann. Dieser wich aus, indem er im letztmöglichen Augenblick zur Seite trat und dem Mursog ein Bein stellte. Wieder ging das Geschöpf zu Boden und wieder stand es auf, noch wütender als zuvor.
Nun hätte der Kampf wohl noch stundenlang auf diese Weise weitergehen können, hätte der Mann das gewollt. Doch er wollte es keineswegs. Er war erschöpft, müde und hungrig. In dieser Auseinandersetzung vergeudete er nur unnötig seine ohnehin schon angeschlagenen Kräfte.
Der Mursog setzte zu einem weiteren Angriff an, doch diesmal kam ihm der Mann zuvor. Die Tatsache, dass er weder Rüstung noch Kleidung trug, machte ihn unheimlich wendig. Vorbei am Dolch seines Feindes schlug er aus dem Lauf zu und traf, wie beabsichtigt, dessen Kehle mit der Handkante. Aus der Drehung setzte er einen Hieb gegen den ungeschützten Nacken des Mursogs nach.
Dieser Schlag wäre bei einem menschlichen Gegner tödlich gewesen, wie er wusste, und wie sich herausstellte, galt dies auch für Mursogi. Der selbsternannte Herrscher kippte vornüber und blieb reglos am aufgeweichten Waldboden liegen.
»Ich habe dich gewarnt«, murmelte der Mann mit aufrichtigem Bedauern.
Dann, als die Hitze des Kampfes langsam nachließ, betrachtete er nachdenklich seine Hände. Woher hatte er die Kraft und das Geschick genommen, um zu tun, was er eben getan hatte? Nicht jeder Mensch konnte einen Feind mit nur zwei gezielten Schlägen töten, so viel war sicher. Sein Körper schien sich an etwas erinnert zu haben, was sein Geist vergessen hatte. Ein weiteres Mal fragte er sich, wer er wohl gewesen sein mochte. Besaß ein einfacher Jäger die Fähigkeiten, Menschen auf diese Weise mit bloßen Händen zu töten?
Wohl kaum. Ein ausgebildeter Krieger dagegen oder ein gedungener Meuchelmörder … Das waren jedoch die einzigen Erklärungen, die ihm einfielen, und vor allem die zweite gefiel ihm nicht sonderlich gut.
Schwer atmend blickte er auf den toten Mursog hinab. Er hatte soeben, ohne mit der Wimper zu zucken, ein Leben ausgelöscht. Eigentlich hätte er sich schuldig fühlen müssen. Dass sich dieses Gefühl in Grenzen hielt, nahm er als sicheres Zeichen dafür, dass dies nicht das erste Mal war, dass er getötet hatte. Ihm war alles andere als wohl bei dieser Erkenntnis. Doch er musste zumindest ein Mann von Ehre gewesen sein, sagte er sich. Sein Pflichtgefühl gebot es ihm nämlich, dem gefallenen Feind die Augen zu schließen. Ein schwacher Trost, im Angesicht der Tatsachen.